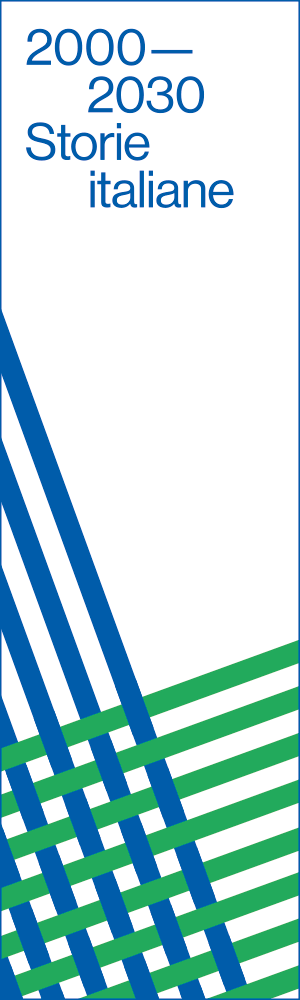Erstmals ist die Autorin und Regisseurin Helgard Haug in diesem Jahr bei den Salzburger Festspielen mit einer von ihr und dem Theater HORA erarbeiteten Fassung von Bertolt Brechts Der kaukasische Kreidekreis zu Gast. Von Schauspielchefin Bettina Hering nach der Identität des Ensembles gefragt, antwortet Helgard Haug: „Es setzt sich zusammen aus zunächst fünf Spielerinnen und Spielern des Theater HORA, das schon seit 30 Jahren existiert. Sie sind eine sehr innovative Bewegung, die auf eine Initiative von Eltern mit der Idee zurückgeht, ihren kognitiv beeinträchtigten Kindern statt der Arbeit in Werkstätten eine Form von kreativer Arbeit zu ermöglichen. So hat sich ein Ensemble von Menschen gebildet, die täglich zu ihrer Arbeit in ein Theaterlabor gehen, in dem sie mit unterschiedlichen künstlerischen Handschriften in Berührung kommen. Dabei entstehen Theaterstücke auf einem sehr professionellen Niveau, in Kooperation mit diversen Festivals und Theatern europaweit. Mit dem Theater HORA kommen auch Kolleginnen und Kollegen mit ins Produktionsteam, die theaterpädagogisch zwischen uns und dem Theater HORA vermitteln.
Und dann gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die ich aus meinem Team mitgebracht habe, wie Barbara Morgenstern als Komponistin, Marc Jungreithmeier als Video- und Lichtdesigner, Laura Knüsel als Bühnenbildnerin oder Minhye Ko, die als Perkussionistin auch eine Rolle auf der Bühne spielt.“
Als „Pionierleistung“ und eine Institution, die sich aus einem privaten Verein heraus auf einem langen Weg etabliert und damit ein eminent wichtiges Zeichen für Inklusion gesetzt hat und weiterhin setzt, stuft Bettina Hering das Theater HORA, das in Zürich ansässig ist, ein.
Angesprochen auf ihre vielfache Zusammenarbeit mit nicht schauspielerisch ausgebildeten „Experten des Alltags“, verweist Helgard Haug auf ihren eigenen, bewusst anderen Weg, der sie, trotz des Studiums der Angewandten Theaterwissenschaften in Gießen, zuerst in die freie Szene geführt hat. Ihr Weg mit dem von ihr mitbegründeten Kollektiv Rimini Protokoll, greife nicht nur auf klassisch dramatisches Theater zurück, sondern beruhe auf unterschiedlichsten Formaten wie installativen szenischen Arbeiten, Bühnenstücken, Interventionen, Hörspielen oder immersiven Projekten – immer mit dem Anspruch, die ’vierte Wand‘ einzureißen. Insofern sei Der kaukasische Kreidekreis als Projekt durchaus ungewöhnlich für ihre eigene Arbeitsweise. Zum besonderen Aspekt der Theaterpädagogik, auf den Bettina Hering im Zusammenhang mit diesem Projekt hinweist, sagt Helgard Haug: „Die Arbeit mit dem Theater HORA ist unter diesem Gesichtspunkt eher ein Bruch als eine logische Fortsetzung. Über die Einladung nach Salzburg habe ich mich sehr gefreut, die Arbeit mit professionellen, nicht von mir selbst einzeln ausgesuchten Schauspieler·innen – da die Auswahl vom Theater HORA nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgte – ist für mich aber tatsächlich eine neue Erfahrung und eine spannende Gegebenheit. Der Bestandteil des Suchens einer Besetzung wird dadurch abgekürzt.“. Vom ersten Kennenlernen an habe man einen langen Anlauf genommen, der schon vor einem Dreivierteljahr begonnen habe. Man habe gemeinsam Workshops besucht, aber auch technisch hinterfragt, wie der Spagat zwischen einer gewissen Werktreue gegenüber Brecht und einer unverbogenen Performance durch die Schauspieler·innen bewältigt werden könne. „Den Prozess des Memorierens und Übens wollten wir den Darsteller·innen ersparen, um ihren kreativen Qualitäten nicht im Weg zu stehen. Ein dreifacher Spagat sei insofern zu bewältigen, als auch die Grenze vom Persönlichen zum Privaten an gewissen Punkten überschritten werden musste.
Wie sie die von Barbara Morgenstern geschaffene Musik auf der Folie derjenigen von Paul Dessau beschreiben würde, möchte Bettina Hering von Helgard Haug wissen. „Barbara Morgenstern hat sich mit der musikalischen Vorlage eingehend beschäftigt und sich genau angeschaut, welche Folgen daraus sie beim Arrangement für die Perkussionsinstrumente übernimmt.“ Andere Instrumente habe man bewusst nicht verwenden wollen. Zum musikalischen Konzept erklärt sie weiter: „Wir haben uns dabei überlegt: Wie können wir die Musik in die szenischen Abläufe integrieren und wie kann man die Darsteller mit einbeziehen?
Die Musik wurde Hand in Hand mit der Erarbeitung der Hauptstruktur entworfen.“ Bettina Herings Frage, ob die Zusammenarbeit mit Barbara Morgenstern ein Beispiel für Kontinuität mit bestimmten künstlerischen Partnern sei, die es erleichtere, schnell zu neuen Punkten zu kommen, bejaht Helgard Haug: „Es ist wunderbar, wenn man einander versteht und eine gemeinsame Sprache entwickelt hat, wenn eine Ästhetik abgeklärt ist und dabei trotzdem immer wieder neue Situationen entstehen, ohne dass es zu einem Stillstand kommt.“
Auf das schwierige Verhältnis Brechts zu Salzburg kommt Bettina Hering zu sprechen und fragt Helgard Haug nach ihren eigenen Lese- und Seherfahrungen mit ihm als Autor. „Brecht war für mich als Regisseurin eigentlich immer etwas, von dem klar war, dass ich es nie machen werde – allein schon wegen der vielen Auflagen seitens des Verlags und der Nachkommen“, erzählt sie. „Brecht war für mich sozusagen verschlossen. Daher habe ich, als ich zuerst gefragt wurde, gedacht: Das ist nicht machbar – die Komponenten Brecht, Rimini Protokoll und Theater HORA schließen einander aus. Letztendlich ist die Realisierung aber doch gelungen“. Zu ihrem eigenen Brecht-Bezug sagt sie weiter: „Ich habe seine Stücke immer gerne gelesen, habe aber zu viele museale Inszenierungen gesehen. Für mich ist es wichtig, seine Texte auf ihre ’Heutigkeit‘ hin zu überprüfen, das war auch Brechts eigener Anspruch.
Mir geht es immer darum, aktuelle Themen gemeinsam auf der Bühne zu verhandeln“. Möglich geworden sei das Projekt letztendlich durch die Lockerungen, denen der Verlag und die Erben zugestimmt hätten. „Das musste ich erst sicherstellen, um eigene dramaturgische Wege gehen zu können, die wichtig sind, um an Tabuthemen rühren zu können“, erklärt sie.
Worin für sie die Hauptthemen des Stücks bestehen, fragt Bettina Hering im Hinblick darauf weiter. „Wir schreiben das Stück fort“, antwortet Helgard Haug. „Wir setzten beim Schluss des Stückes bei der Gerichtsszene an, die danach fragt, welches die richtige Mutter ist, die leibliche oder die soziale Mutter. Brecht gibt darauf eine klare Antwort, auch vor dem Hintergrund der Gegensätze zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Wir vollziehen das erst einmal nach,
fragen dann aber: Welche anderen Personen kommen für die Mutterrolle noch in Frage? Und diese Frage übergeben wir an das Kind als Subjekt, das sich selbst entscheidet. Auf diese Weise erzählen wir die Probe insgesamt acht Mal und schauen immer wieder, was dabei zu veränderten Bedingungen herauskommt“.
Auch Identitätsfiguren gebe es dabei: „Es gibt verschiedene Schauspieler·innen, die sich ihre Rollen ausgesucht haben. Und wir erzählen im Stück auch, wie es zu diesen Rollenbesetzungen kam. Dafür haben sie sich zum Teil erst über Improvisationselemente entschieden.“ Insgesamt gebe es weniger Textprojektion als in ihren letzten Arbeiten, verrät
Helgard Haug. Es werde vielmehr auf verschiedenen, auch technischen und visuellen Ebenen gearbeitet. Ein Schauspieler werde beispielsweise via Bildschirm live zugeschaltet, da er für die Reise nach Salzburg physisch nicht belastbar genug sei. „Ein sehr wichtiges Element bestehe für mich darin, dass ein Großteil des Brecht-Texts rhythmisch präzise gesprochen wird. Um das zu erreichen, wird den Darsteller·innen der Text zunächst ’in-ear‘ zugeflüstert, verschwindet dann aber wieder. Über diese Zuspielung werden die Schauspieler·innen sozusagen in eine bestimmte Form gebracht“.
Ob das von den Schauspieler·innen gut angenommen wurde, möchte Bettina Hering wissen. „Das war ein langer Weg“, sagt Helgard Haug. „Wir haben früh damit angefangen und dabei Fragestellungen ausgelotet wie: Wie fühlt sich das an? Kann ich dabei die Aufmerksamkeit für meine Mitspieler·innen auf der Bühne wahren? Auch die Hürde des Schweizerdeutschen war teilweise zu überwinden“.
Mit Blick auf die Hörspielfassung, die parallel zur Inszenierung entsteht und zeitgleich mit der Premiere im Radio gesendet wird, sagt Helgard Haug im Vergleich zu ihren sonstigen Hörspielprojekten: „Das geschieht sonst eigentlich in großem Abstand zur Theateraufführung – entweder davor oder danach. Hier passiert es aber gleichzeitig, wir haben schon in Zürich Texte eingesprochen und die Musik aufgenommen, das schneiden wir nun alles für das Hörspiel zusammen“.
Andere, zukünftige neue Projekte entstünden auch wieder parallel mit den Kollegen von Rimini Protokoll in unterschiedlichen Konstellationen, erläutert sie. Auch den neuen Horizont, der sich ihr kürzlich als Autorin des Buchs zu dem Stück All right, good night, das 2022 zum Berliner Theatertreffen eingeladen war, eröffnet habe, empfindet sie als spannend: „Im Vergleich zur Theater- oder Hörspielfassung ergibt sich eine ganz neue Reichweite und eine neue Form der Kommunikation mit ganz anderen Menschen“.
Im Bild: Helgard Haug (Konzept und Regie), Bettina Hering (Leitung Schauspiel)/© SF/Jan Friese