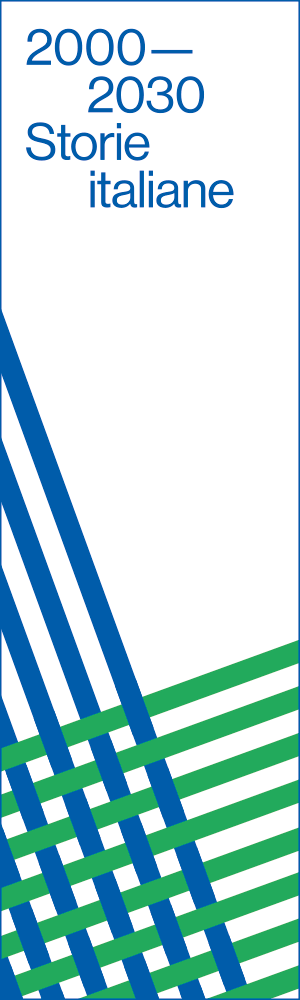Wie die Analyse von Umwelt-DNA den Blick unter die Seeoberfläche revolutioniert und die präzise Erfassung von Fischarten in Seen schonend ermöglicht, zeigt ein Forschungsteam der Universität Innsbruck in Kooperation mit der AGES und dem Bundesamt für Wasserwirtschaft in Scharfling am Beispiel Mondsee.
Statt Fische wie bisher mit Netzen oder Strom zu fangen, analysierten die Forschenden im Labor die DNA-Spuren, die Fische ins Wasser hinterlassen – etwa durch Hautzellen oder Ausscheidungen –, um die Verteilung und die Lebensräume von Fischen im oberösterreichischen Mondsee zu bestimmen.
Die Studie zeigt, dass die Lebensraumpräferenzen verschiedener Fischarten – einige bevorzugen flache Uferbereiche, andere leben in der Tiefe oder in der Nähe von Zuflüssen – mit den räumlichen Mustern der DNA-Nachweise übereinstimmen. So wurde die DNA von Reinanken und Seesaiblingen vor allem in den tieferen Bereichen des Sees gefunden, während die DNA von Aiteln und Brachsen überwiegend in den Uferbereichen nachgewiesen wurde. Besonders effizient erwies sich das Sammeln von Wasserproben entlang der Uferlinie: Schon mit wenigen horizontal integrierten Proben – das sind Wasserproben, die mit einem speziellen Wasserschöpfer in bestimmten Tiefenbereichen (von 0 bis 20 m und von 20 m bis zum Grund) entnommen werden – konnte ein Großteil der Arten nachgewiesen werden. Die Zahl der nachgewiesenen Arten nahm mit zunehmender Beprobungstiefe deutlich ab. Insgesamt wurden 25 Fischarten identifiziert, darunter auch der im Mondsee geschützte Perlfisch (Rutilus meidingeri). Es gelang sogar der Nachweis von drei Arten, die bei der herkömmlichen Befischung nicht erfasst wurden.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass eDNA-Metabarcoding ein leistungsfähiges Werkzeug für das Gewässermanagement ist — insbesondere für die Überwachung von Fischgemeinschaften und den Schutz sensibler Arten“, sagt der Erstautor der Studie, Hans Rund.
Diese Methode schont die Tiere, spart Aufwand und liefert trotzdem sehr präzise Daten über die Fischbestände. Bereits mit einer relativ kleinen Anzahl von integrierten Proben können die im See vorkommenden Fischarten nachgewiesen werden. Die Methode könnte es zukünftig erlauben, ein möglichst vollständiges Arteninventar im Rahmen des ökologischen Monitorings von Seen zu erhalten. Das spielt eine noch größere Rolle, wenn man berücksichtigt, dass sich die Lebensräume im Wasser durch den Klimawandel zunehmend verändern.
Diese Publikation ist Teil der Doktorarbeit von Hans Rund, die er im Rahmen des Interreg Projekts Eco-AlpsWater und betreut durch Forschungsgruppenleiter Josef Wanzenböck und Projektleiter Rainer Kurmayer ausarbeitet.
Publikation: Rund H., Kurmayer R., Dobrovolny S., Luger M., Wanzenböck J. (2025). Application of eDNA metabarcoding to assess spatial distribution and habitat use by freshwater fish in a peri-alpine lake, Ecological Indicators 174: 113459, DOI: 10.1016/j.ecolind.2025.113459
Copyright: Thomas Ebner (CC BY 4.0)